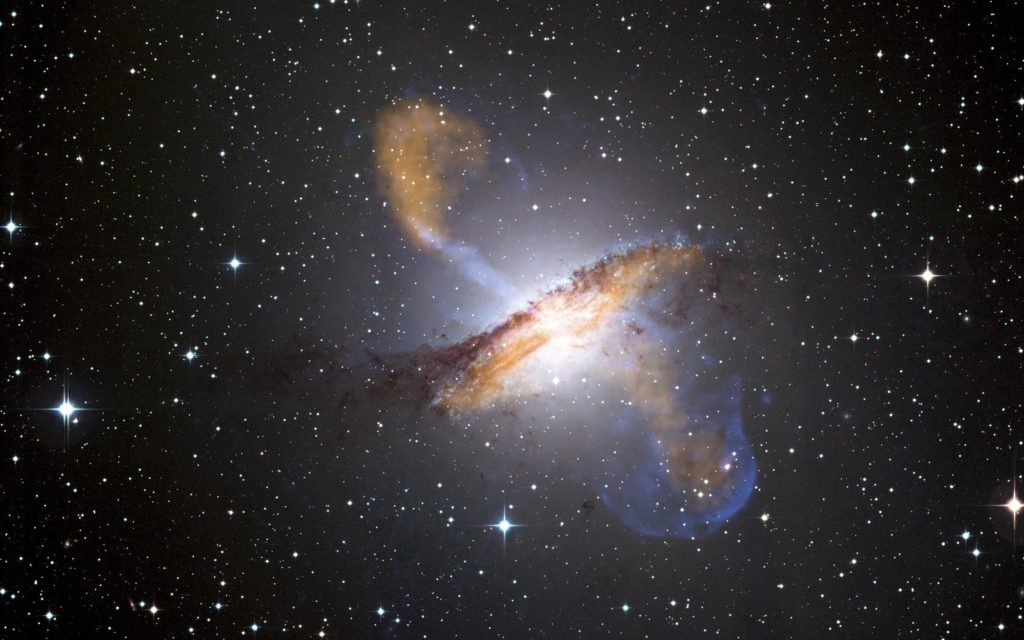
Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum hat unsere Energie ausgerechnet diese banale menschliche Form angenommen? Warum nur hat es uns auf diesen winzigen blauen Planeten verschlagen, der irgendwo in einem unwichtigen Winkel des Universums um eine unbedeutende Sonne kreist?
Etwa drei Milliarden Herzschläge, eine halbe Milliarde Atemzüge sind uns gegeben, wenn wir unsere Lebensspanne ausschöpfen dürfen, bevor wir diese Existenz wieder verlassen werden.
Wofür? Wozu?
Zen ist an dieser Fragestellung nicht interessiert. Wir sind da, das genügt. Jede Idee, warum wir existieren, ist einzig wieder Konzept, dass uns davon abhält, einfach nur DA zu sein. Über den Sinn des Lebens zu reflektieren ist nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv. So habe ich es gelernt.
Allerdings stand immer Willigis dagegen, der Zen-Meister, aber gleichzeitig Mystiker war. Und Priester. Das wohl zu allererst. „Warum bist Du da?“ hat er immer wieder gefragt.
„Aus tiefstem Herzen sage ich Euch allen: Immer geht es um Leben und Tod. Alles vergeht und kein Verweilen kennt der Augenblick. Darum seid immer wachsam, nie nachlässig, nie vergesslich.“ Das ist der Spruch, mit dem der Assistent jedes Sesshin am Hof eröffnet und mit dem wir am Ende auch wieder entlassen werden. So viel zur Idee, Meditation würde der Entspannung dienen.
Sowohl Zen als auch Tantra sind Teil des Mahajana-Buddhismus. In dieser Tradition ist das Ziel nicht nur die eigene Verwirklichung, sondern die Erlösung aller Lebewesen. Deshalb ist das Ideal des Mahajana-Buddhismus der Bodhisattva: ein Praktizierender, der auf dem Weg so weit fortgeschritten ist, dass er Erleuchtung – und damit das Eingehen ins Nirvana – erlangen könnte, aber freiwillig so lange immer wieder menschliche Existenz annimmt, bis auch das letzte Lebenwesen von Leid befreit sein wird. In der Zen-Praxis sind es die „vier großen Gelübde“ im Vajrayana „Bodhicitta“ – aber das Prinzip ist das gleiche. Rituell wird als Teil der Praxis der Wunsch ausgedrückt, Erleuchtung nicht nur zum eigenen Nutzen zu erlangen, sondern zum Wohle aller.
Wie das Bodhisattva-Gelübde im Alltag am Besten gelebt werden kann, ist eine komplizierte Frage. Wann ist man auf dem Weg so weit fortgeschritten, dass man berufen, verpflichtet und kompetent genug ist, Anderen zu helfen? Wo enden Narzissmus und Selbstausbeutung, wann beginnt spirituelle Verpflichtung? Ein schwieriges Thema: so mancher, der weit fortgeschritten ist, traut sich nichts zu – und viele, die es nicht sind, fühlen sich berufen, obwohl sie nur Unheil anrichten.
Auch hier lauert Mara an jeder Kreuzung.
Seit etwa einem Jahr passiert es mir immer wieder, dass mir etwas gesagt wird in der Art von: „So jemanden wie dich hatte ich mir gewünscht.“ Oder: „Du bist das, was mir gefehlt hat.“ Die etwas melodramatische Version „Dich schickt der Himmel!“ habe ich auch schon zu hören bekommen.
Meine aktuelle Hypthese dazu ist, dass ich eine Art „Mary Poppins für schwierige Fälle“ zu sein scheine. Ich komme nicht mit dem Ostwind zu netten Kindern gesegelt, sondern treffe in allen möglichen – und des öfteren unmöglichen – Situationen auf Menschen, die irgendwie in ihrem Leben feststecken. Es kommt mir zumindest so vor, als wäre es das, was alle gemeinsam haben, so verschieden sie auch sonst sind.
Und man scheint sich mich wünschen zu müssen, sonst klappt es nicht. Ich weiß, es klingt völlig abgedreht und ziemlich narzisstisch, aber – wie gesagt – es ist das, was mir immer wieder mitgeteilt wird.
Das Experiment läuft noch, es liegen lediglich Zwischenergebnisse vor. Die bisher erhobenen Daten lassen sich so interpretieren, dass es das eine ist, sich jemanden wie mich zu wünschen. Und etwas völlig anderes, mit den Konsequenzen meiner Präsenz klar zu kommen.
Ich scheine immer so etwas wie eine Einladung zu sein, die man annehmen oder ausschlagen kann. Die Ausfallquote ist hoch, habe ich gelernt. Die „schwierigen Fälle“ treffen unter den wunderlichsten Umständen auf mich. Aber sich in der Tiefe auf mich einzulassen um den enstprechenden Nutzen für das eigene Leben daraus ziehen zu können, ist nicht vielen von ihnen gegeben. Die meisten tauchen auf, freuen sich, erschrecken kurz darauf zutiefst und verschwinden wieder.
„Wer kommt, ist willkommen. Wer geht, wird nicht aufgehalten“, heißt es im Zen. So versuche ich es zu handhaben: wer auf mich trifft und mit mir etwas anzufangen weiß, den versuche ich anzunehmen, auch wenn er nicht meinen Vorstellungen entspricht oder ich eigentlich gerade etwas anderes vorhatte. Und wer mich wieder verlässt, obwohl mir mein Gefühl sagt, dass er eigentlich bleiben sollte, den lasse ich ziehen. Eine interessante und des Öfteren herausfordernde Übung in Akzeptanz.
Ich bin gespannt, was noch aus dieser Mary-Poppins-Sache werden wird. Es scheint die aktuelle Resonanz im Außen auf das zu sein, was sich in meinem Inneren abspielt. Alles ist fluide, in jedem Augenblick kann es anders sein. Schon morgen können alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie auf mich treffen. Ich würde mich zähneknirschend – und sicher des Öfteren wenig erfolgreich – darin üben, es ok zu finden.
Warum wir in diese Existenz hineingeboren wurden, werden wir nie wissen, denke ich. Deshalb hat Zen recht, dass es müßig ist, ein Konzept daraus zu machen. Und Willigis hat recht, dass er trotzdem so beharrlich danach gefragt hat: es ist unserer Natur eingeschrieben, dass wir für etwas leben wollen, das über die eigene Existenz hinaus reicht. Lebewesen von Leid befreien zu wollen auf eine Art und Weise, die uns entspricht und Anderen angemessen ist, löst das Boddhisattva-Versprechen ein – und ist eine Antwort auf Willigis Frage, die ihn wohl gefreut hätte.
Schreibe einen Kommentar