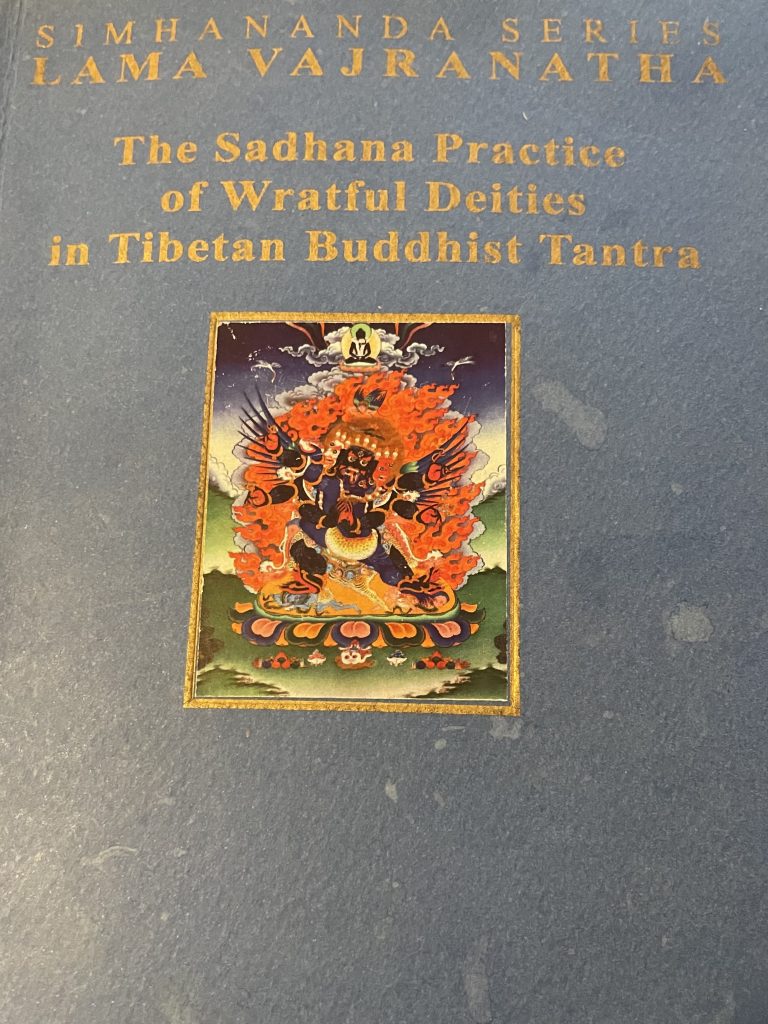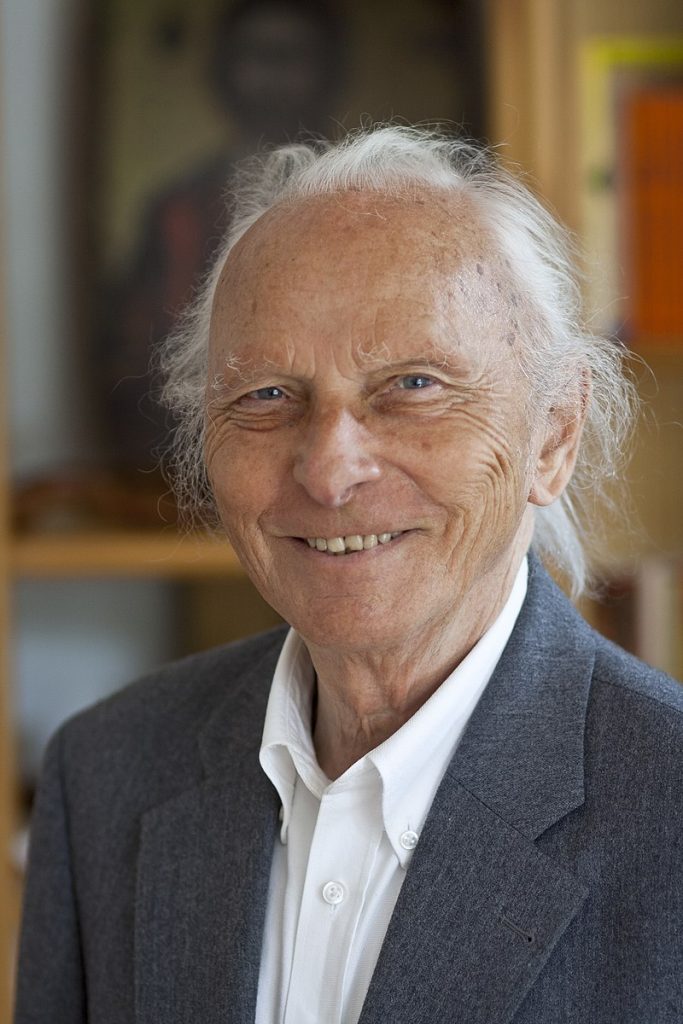Vier Dinge braucht es, um erleuchtet zu werden:
Buddha: das Vertrauen in die eigene Buddha-Natur
Dharma: die Lehren des Buddha
Lama: den spirituellen Lehrer
Sangha: die spirituelle Gemeinschaft
Das Vertrauen in die eigene Buddha-Natur bildet den „Motor“ – den Antrieb – für die Praxis. Es ist tief im Unbewussten vergraben wie ein Samen, der darauf wartet, dass er von Wärme und Feuchtigkeit zum Leben erweckt werden wird.
Wenn die Umstände günstig sind, beginnt dieser Samen zu keimen, zarte Wurzeln zu schlagen, sich beharrlich an die Oberfläche zu arbeiten. Die „Sonnenstrahlen“, die das zarte Pflänzchen ins Leben gerufen haben, können von einem spirituellen Lehrer ausgeschickt worden sein, von eine kraftvolle Sangha, manchmal auch von einem Praktizierenden, der genug Verdienste angesammelt hat, um andere daran teilhaben zu lassen.
Das Vertrauen in die eigene Buddha-Natur ist das tiefe Wissen darüber, in der Essenz energetisches Bewusstsein zu sein, das von allem Leid befreit werden kann. Nur wenn dieses Wissen aktiviert worden ist, kann der Weg gegangen werden. Aber auch dann ist er hart und steinig. Und an jeder Kreuzung lauert Mara – der buddhistische Teufel – um den Praktizierenden zu täuschen und in die Irre zu führen.
Deshalb ist ein guter Lehrer existentiell. Und eine starke Sangha – eine Gemeinschaft von Praktizierenden. Der Lehrer führt und leitet, die Sangha hält und unterstützt.
Ich habe vortreffliche Lehrer – und gleich zwei gute Sanghas. Die eine – meine Zen-Online-Sangha – trägt mich durch ihre zuverlässige Präsenz: jeden Morgen und Abend sind wir via Zoom miteinander verbunden. Wir meditieren gemeinsam, ich kenne inzwischen ihre Sitzecken und Wohnzimmer. Siehe da, Jürgen und seine Frau sind gerade im Urlaub, sie meditieren um sechs Uhr morgens auf den Fahrersitzen ihres Wohnmobils. Und Ute sitzt schon im Garten, bei diesen Temperaturen! Wenn wir uns zu Sesshins am Hof treffen, gibt es immer ein Hallo: „Sitzt du nicht auch immer mit mir?“ Aber während der Retreats wird geschwiegen. Ich kenne und mag viele, näheren Kontakt habe ich zu niemandem.
Glücklicherweise habe ich noch meine Tantra-Sangha. Im Tantra ist es etwas Besonderes, mit anderen Schülern eine gemeinsame Praxis und einen gemeinsamen Lehrer zu teilen. Man wird zur Dharma-Schwester und zum Dharma-Bruder – zur spirituellen Verwandtschaft – mit der man auf vielfältige Weise verbunden ist.
Als die Khandro uns im Januar nach dem letzten Durchgang des Mantra-Retreats verabschiedete, hat sie uns genau das bescheinigt: dass wir eine richtige Sangha geworden sind. Sie würde es spüren, wir hätten jetzt als Gemeinschaft die richtige Energie. Viele von uns würden schon seit Jahren gemeinsam praktizieren, und jetzt, wo wir auch noch einen festen Ort gefunden hätten, wären wir zusammengewachsen, erklärte sie uns und freute sich sichtlich darüber. Wir konnten ihr nur zustimmen, genauso hatte es sich auch für uns angefühlt.
Jetzt – während der Retreats im März – vermisse ich meine Dharma-Schwestern und Brüder. Wir waren anfangs vier Praktizierende, eine hat uns gestern verlassen, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Und das bei einer so kraftvollen Praxis wie Vajrakilaya! Während ich zu den Trommelschlägen des Rinpoche gemeinsam mit den beiden Anderen laut die Texte rezitiere, spüre ich die Leere an der gegenüberliegenden Wand. Es fühlt sich an, als wäre da ein Loch, das ich ständig mit Energie füllen muss.
Es kommt mir vor, als würde ich ihre Anwesenheit spüren, ein seltsames Gefühl, das mich immer wieder überkommt, während ich völlig in der Rezitation aufgehe und die tibetischen Silben mit der Kraft meines Wurzel-Mantras ausstosse. Es sind drei aus der Sangha, von denen ich das Gefühl habe, sie müssten eigentlich da sein. Zwei Dharma-Brüder, eine Dharma-Schwester.
Mit der Dharma-Schwester habe ich gestern lange telefoniert, wir sind uns verbunden, tauschen fast täglich Nachrichten aus. Sie hat eine phantastische Energie, schillernd und kraftvoll, es ist immer ein Genuß, mit ihr zu praktizieren. Kein Wunder, dass ich sie vermisse.
Während der Pause am Nachmittag sehe ich zu meiner Verblüffung, dass einer der beiden Dharma-Brüder – und zwar der, der mir gefühlt gegenüber sitzt – versucht hat, mich anzurufen. Na so etwas! Ich habe ihn erst im Januar kennengelernt, wir führten ein einziges – intensives – Gespräch, tauschten Telefonnummern aus und das war es dann gewesen. Was will er auf einmal von mir? Am Abend rufe ich zurück. Er ist erstaunt, als er hört, dass ich gerade bei Uriel und im Retreat bin. „Ach, ist da gerade was?“ fragt er. Nein, von meinem Blog hat er auch noch nicht gehört.
Er hätte in den letzten Tagen immer wieder an mich gedacht – warum auch immer – und spontan beschlossen, mich anzurufen, erklärt er mir. Wir führen ein einstündiges Gespräch, es ist, als würden wir uns seit vielen Jahren kennen. Zum Abschied versichern wir uns gegenseitig, wie schön es war, von einander zu hören. Wir wären eben Sangha, meint er noch, bevor er auflegt.