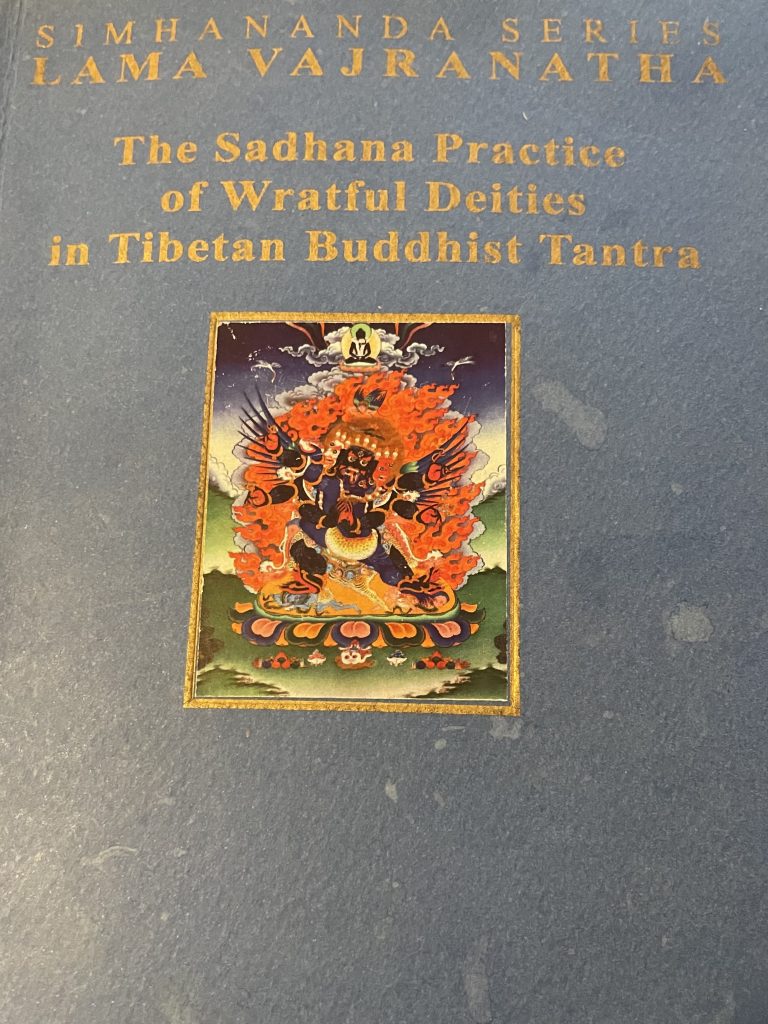Meditationspraxis muss gefunden werden. Manche laden sich eine App herunter, buchen einen Kurs im Wellness-Hotel. Selbst diese Aktivitäten – so banal sie Hard-Core-Meditationsjüngern scheinen – benötigen einen Impuls, eine innere Suchbewegung. Wenn diese stark genug ist, wird auf dem Radarbildschirm des Bewusstseins irgendwo ein grüner Punkt aufleuchten. Da ist sie – eine Praxis!
Aber jede Praxis wird von einem Wächter beschützt. Er ist ein Archetypus, eine tief im individuellen wie kollektiven Bewusstsein verborgene Figur, präsent in Mythen und Geschichten seit Anbeginn der Menschheit. Der Wächter hat eine wichtige Funktion: er prüft den Willen des potentiellen Adepten.
Zum ersten Mal manifestiert er sich, wenn die Praxis in greifbare Nähe rückt. Manchmal als Zweifel: ist es wirklich das richtige für mich, sollte ich nicht lieber X,Y,Z machen? Des Öfteren nimmt er die Gestalt von Trägheit an und lässt alleine das Buchen des Retreats zu einer nicht zu bewältigenden Kraftanstrengung werden. Häufig tarnt er sich als Getriebenheit: es muss noch so viel erledigt werden, bevor ich – irgendwann – ein Retreat buchen kann.
Der Wächter der Praxis kann sich auch im Außen manifestieren: als Partner, der überhaupt nichts von solchen Albernheiten hält, als Krankheitsfall in der Familie, der in letzter Minute eine Stornierung erzwingt, als ungeduldiger Vorgesetzter, der genau an dem Wochenende Einsatz fordert, an dem das Retreat angesetzt ist.
Den wenigsten, die das erste Mal in einem Meditationskurs sitzen, ist bewusst, dass sie zu den „Happy Few“ gehören. Zu denen, die den ersten Wächter auf dem Weg zur Erleuchtung erfolgreich überwunden haben.
Aber schnell stellt sich heraus, dass es nur ein kleiner Etappensieg war. Kaum beginnt die Unterweisung in die Praxis, ist er wieder da, der Wächter. Während des ersten Zur-Ruhe-Kommens, wenn die Wellen der Emotionen flacher und flacher werden und vage Bilder aus dem Unbewussten aufzusteigen beginnen, prüft er erneut. Im Zen manifestiert sich der Wächter zu Beginn der Praxis vor allem in Form von körperlicher Unruhe und Schmerz. Viele sind völlig überfordert davon, dass es auf einmal buchstäblich „nichts zu tun“ gibt. Über Stunden und Tage nichts anderes als stilles Sitzen auf dem Kissen, dazu der Atem, der kommt und geht.
Begleitet vom Bewusstsein, dass jede kleine Bewegung – das Kratzen an der juckenden Nase, das Verlagern des schmerzenden Knies – die donnernde Stille des Zendos stören würde, man ertappt wäre dabei, in der Praxis nachzulassen. Und je heftiger der innere Widerstand gegen das stille Sitzen wird, je mehr man den erlösenden Gongschlag herbei sehnt, um so unerträglicher werden Unruhe und Schmerz.
Es ist die existentielle Erfahrung des völligen Zurückgeworfen-Werdens auf sich selbst. Nie ist man einsamer und sich selbst mehr ausgeliefert als auf dem Kissen. Die meisten haben sich Meditation anders vorgestellt. Man erwartet Wellness und Glücksgefühle, statt dessen findet man sich in einer Folterkammer wieder. Dazu die Strenge und Kühle des Lehrers, wo man doch geliebt und angenommen werden möchte! Wieder hat der Wächter seine Pflicht getan. Aus den „Happy Few“ sind die „Happy very few“ geworden.
Und so geht es immer weiter, Retreat um Retreat, Jahr um Jahr. Der Wächter lässt nie nach in seinem Bestreben, zu prüfen, ob man es wirklich ernst meint mit der Praxis. Er ist unermüdlich, immer im Dienst und gnadenlos. Je höher der Gewinn, der mit einer Praxis einher geht, um so unerbittlicher seine Prüfung. „Meinst du es wirklich ernst?“ fragt er wieder und wieder. „Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen?“
Und der Preis ist hoch: viele bezahlen den Gewinn aus der Praxis mit dem Verlust von Ehepartnern, sozialem Ansehen, der Sicherheit zu wissen, wer und was sie sind, wo sie hingehören.
Die Praxis bringt existentielle Unruhe ins Leben, denn das ist ihr Auftrag: der Weg zur Erleuchtung ist gepflastert mit dem Abschied von Konzepten. „Wenn du deine Mutter triffst, töte deine Mutter. Wenn du den Buddha triffst, töte den Buddha“, lehrte Rinzei. „Es gibt nichts, was heilig ist.“ Alles muss in jedem Augenblick in Frage gestellt werden. Jede Sichtweise, jede Idee davon, wie ich bin, wie Andere sind, wie die Welt zu sein hat, ist einfach nur Konzept, das von der Realität abschneidet.
Meine Zen-Lehrer lehrten mich, den Wächter in allen seinen Erscheinungsformen zu würdigen. Nie begegnet man sich selbst direkter und ungeschminkter, als in den Momenten, in denen er prüft. Er legt alle Schwächen, Phantasien und Ausflüchte gnadenlos bloß. Wenn das erkannt und akzeptiert werden kann, wandelt er sich vom Gegner zum Verbündeten.
Wenn er sich mir in den Weg stellt, falte ich die Hände vor der Brust und verneige mich – meist zähneknirschend – tief vor ihm, um ihm meine Dankbarkeit für sein pflichtbewusstes Werk zu zeigen.