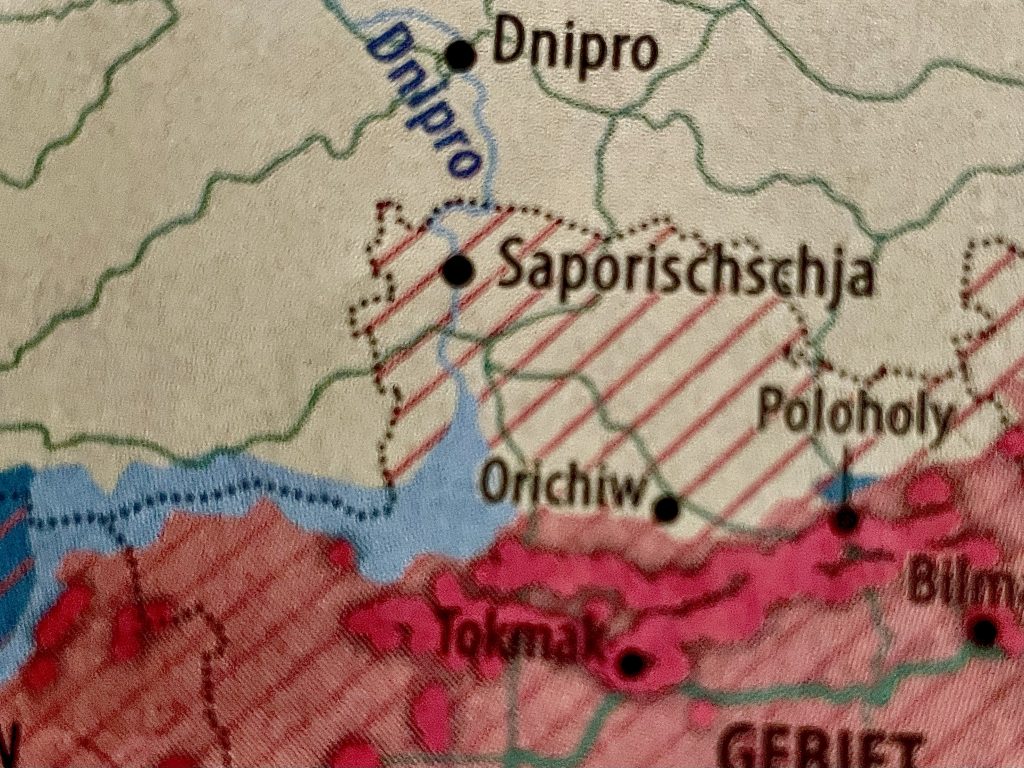Mein großes Vorbild, wenn es ums Schreiben geht, ist Bruce Springsteen. Kein Witz!
Stimmigerweise habe ich ihn nicht über seine Musik entdeckt, sondern über sein Buch. Genauer: über seine Autobiographie. Im Feuilleton meiner geliebten Tageszeitung las ich eine hymnische Besprechung darüber. Wie gut sie geschrieben wäre. Und wie klug Springsteen seine Beziehung zum bipolaren Vater reflektieren würde. Das war das Stichwort, dass mich das Buch bestellen ließ: „bipolar“.
Das Thema beschäftigt mich schon länger. Obwohl ich nicht selbst betroffen bin. In meiner Familie sind sie über Generationen alles mögliche und unmögliche gewesen, aber verrückt im Sinne von „psychotisch“ war meines Wissens keiner. Die Familiengeschichte einer Freundin war es, die mein Interesse daran auslöste. Bei ihr wandert ein manisch-depressives Familiengespenst durch den Stammbaum, fällt mal den einen, dann den anderen an. Fast keine Generation bleibt verschont. Und ich war irgendwie mit drin in dieser Familiengeschichte, ohne dass ich mir erklären konnte, wie es zuging. Ich träumte von ihr und ihren verrückten Angehörigen, es beschäftigte mich Tag und Nacht.
Als ich zu schreiben begann, tat ich es für diese Freundin. Es war ein spontaner Einfall nach der Abendmeditation. Aus einer Laune heraus tippte ich die ersten beiden Kapitel einer Geschichte herunter mit dem Gedanken, die Freundin würde es vielleicht gerne lesen. Ich hatte die Protagonisten und die Ereignisse während des Zazen „gesehen“. Ich hängte den Text an eine Mail, gab die Adresse der Freundin ein, schrieb ein paar Worte dazu und ging zu Bett, nachdem ich die Nachricht abgeschickt hatte. Am nächsten Morgen kam die Antwort: wie schade, dass es nur der Anfang der Geschichte wäre!
So wurde ich unversehens zur Chronistin meiner inneren Bilder. Allerdings war ich schnell mit einer Vielzahl technischer Probleme konfrontiert. Ich „sah“ zwar bei jeder Meditationseinheit, was die Charaktere der Geschichte trieben, aber oft war ich überfordert davon, es zu Papier zu bringen. Bilder und Emotionen so in Sprache zu übersetzen, dass es Andere verstehen – lernte ich – erfordert handerwerkliches Können. In welcher grammatischen Zeitform soll ich schreiben? Welcher Erzählperspektive soll ich wählen? Wie beschreibe ich Orte und Landschaften, dass sie für Außenstehende nachvollziehbar sind? Außerdem „sah“ ich wie meine Protagonisten mit sich selbst und mit Anderen sprachen, aber ich „hörte“ sie nicht. Irgendwie wusste ich trotzdem, was sie umtrieb, aber wie ich ihnen eine authentische Stimme geben sollte, war mir ein Rätsel.
Ich bestellte stapelweise Literatur zum Thema „Schreiben“ und absolvierte online einen „Kreativen Schreib-Kurs“, während ich mich tagsüber arbeitend und nachts träumend mit meinen Charakteren und ihrem Schicksal herumschlug.
Erst dachte ich, ich schreibe einen Krimi. Ganz falsch lag ich nicht, die Geschichte kreiste um ein lang zurückliegendes Verbrechen, ein Mordanschlag konnte gerade noch vereitelt werden. Aber nach einigen Wochen harter Arbeit wurde es mehr und mehr zu einer Liebesgeschichte! Das war das letzte, woran ich interessiert war – zu viel Gefühl! Ich versuchte mit allen Tricks und Mitteln, meine Figuren in andere Bahnen zu lenken. Ich hatte ja inzwischen gelernt, wie es ging: ich plotete, entwarf in Tabellenform Handlungsmuster, -Motive, Zeitverläufe – vergebens. Das erste Mal war ich mit dem Eigensinn meiner Figuren konfrontiert. Sie verschränkten die Arme vor der Brust, schoben die Unterlippen nach vorne und weigerten sich, weiter mitzuspielen. Da konnte ich noch so stur sein – meine Charaktere waren sturer!
Schließlich gab ich auf und wurde wieder zur Chronistin meines Innenlebens. Andere können sich Geschichten ausdenken – ich kann sie nur niederschreiben.
Allerdings brachte mich an meine Grenzen, was sich da in meinem Inneren abspielte: es ging um eine psychische Erkrankung, lernte ich. Und um Intimität. Beides sind nicht meine Spezialgebiete. Mit dem einen bin ich auf der persönlichen Ebene noch nie in Berührung gekommen, zweiterem bin ich immer so elegant als möglich aus dem Weg gegangen.
Es half nichts! Meine Figuren hatten an einer Weggabelung der Geschichte diese Abzweigung genommen und ich musste mit, ob ich wollte oder nicht. Nur leider war ich schlecht gerüstet für den emotionalen Parcours, über den sie mich jagten. Es war schon kompliziert genug, zu beschreiben, was sie taten und was sie sagten. Aber wie sollte ich es hinbekommen, glaubwürdig darüber zu berichten, was sie fühlten?
Genau in diesem Augenblick fiel mir die Autobiographie von Bruce Springsteen in die Hände. Es war nicht das erste biographische Buch, dass ich zum Thema „psychische Erkrankung“ las. Aber das hier hatte eine andere Qualität. Die Direktheit, mit der „der Boss“ schrieb, nahm mir den Atem. Während ich mich durch sein Leben arbeitete, hörte ich gleichzeitig zum ersten Mal nicht nur seine Musik – sie hatte mich nie angesprochen – sondern auch seine Texte. Es waren lakonische Miniaturen der Menschlichkeit. Sie berührten mich zutiefst. Irgendwie hatte er es drauf, mit ein paar Strichen und Sätzen komplexe Geschichten zu erzählen – und die Emotionen mit der Wucht einer Abrissbirne dazu zu liefern.
Und dabei konnte er nicht mal singen! Es war mir nie aufgefallen. Erst als ich es in seinem Buch las und mir die Songs bewusst darauf hin anhörte, wurde mir klar, dass er recht hatte. In den frühen Alben trifft er regelmäßig nicht mal den richtigen Ton! Er sang trotzdem – und kam gut an damit.
Seine erste Band hatte er mit fünfzehn, lernte ich. Er war Gitarrist, sie coverten Songs für Tanzveranstaltungen. Mitte der 60er, schrieb er, war es üblich, dass Bands nur instrumental spielten, die Leute kamen, um zu den Hit´s aus dem Radio zu tanzen, mehr wurde nicht erwartet. Mit den Beatles änderte sich das, er begann die ersten Texte und Songs zu schreiben, aus der Cover-Band wurde eine richtige. Gesungen wurden Springsteens Songs von einem Frontmann, Bruce traf die Töne nicht.
Dummerweise traf der Frontmann die Emotionen nicht. Irgendwann wurde deshalb aus dem Gitarristen auch noch der Sänger der eigenen Songs, Springsteen nahm Gesangsunterricht und lernte, dass er nicht melodisch klingen musste, um zu überzeugen.
Es geht immer darum, möglichst präzise in Worten und Bildern zu beschreiben, was man spürt, lernte ich vom „Boss“. Die Leitfrage für einen guten Text ist immer: was will ich emotional sagen? Das haute mich um. Ich ließ mich darauf ein – und sitze seitdem des Öfteren über Stunden in Tränen aufgelöst am Schreibtisch. Nach dem Schreiben von Gewaltszenen stehe ich buchstäblich unter Schock. Und hat schon mal jemand eine Sex-Szene geschrieben? Ich kann allen nur raten, es mal auszuprobieren! Viel Spaß damit! Mehr Scham geht nicht…
Nur wenn ich jeden Selbstschutz fahren lasse und mich nackt und verletzlich den Gefühlen meiner Charaktere ausliefere, kann ich wirklich schreiben. Es braucht nicht melodisch zu klingen, gut auszusehen, logisch stringent zu sein – es muss berühren. Nur dann hat es Anderen wirklich etwas zu sagen.
Das war die Lektion, die mir Bruce Springsteen erteilt hat. Er war – und ist – mein großes Vorbild.