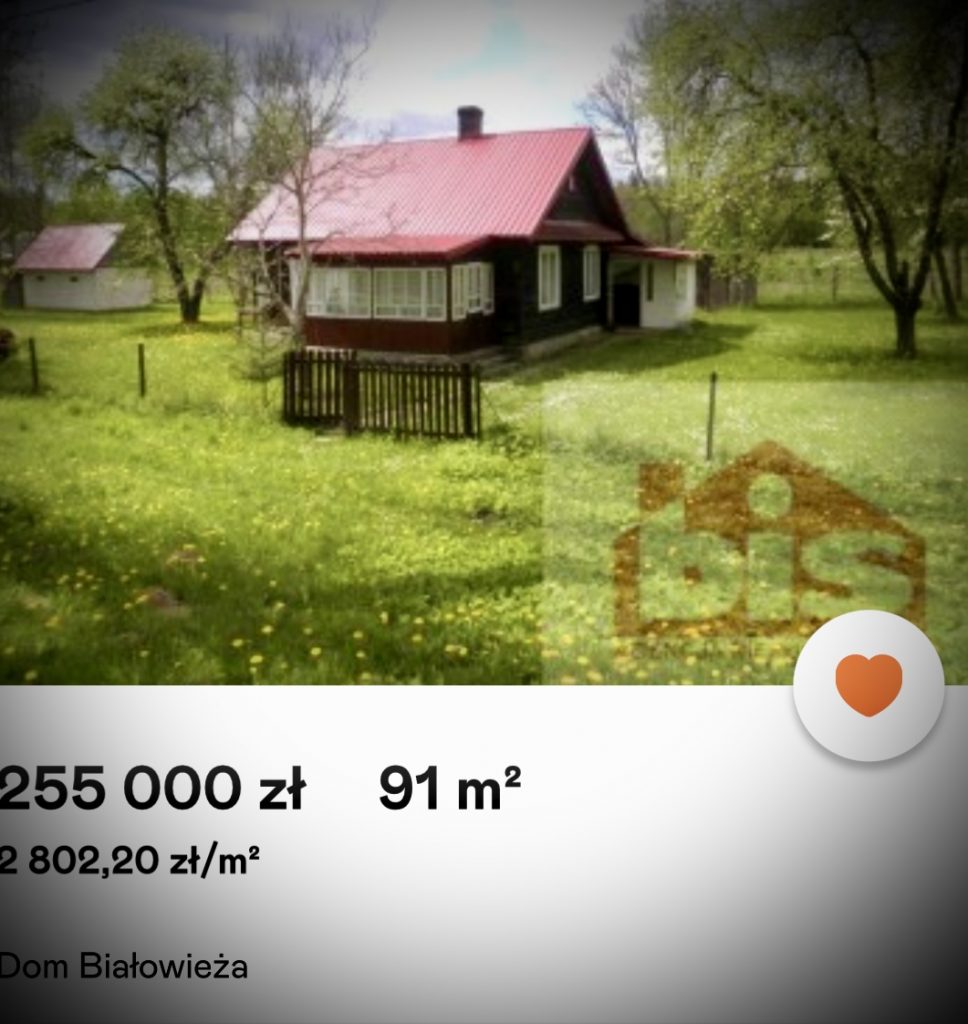Ich vermisse meine Seele, die im Nationalpark von Bialowieza zurückgeblieben ist, ziehe ein erstes – esoterisches – Fazit meiner Urwald-Reise und fasse einen Entschluss…

Mein Leben in Leipzig ist wieder Business as usual:
Ich meditiere täglich und treffe genauso regelmäßig Maria.
Tagsüber sitze ich am Schreibtisch, arbeite vor mich hin und versuche dabei, den üblichen Unfrieden in der verwunschenen Untermietwohnung auszublenden. Wenn mir das nicht mehr gelingen will, radle ich an einen der Seen im Leipziger Umland und schreibe – in der Hängematte liegend – auf dem iPad weiter.
Alles wie gehabt…
Nur: irgendwie ist zwar mein Körper wieder aus dem Urwald zurückgekehrt – aber nicht meine Seele.
Die wandert weiterhin Nacht für Nacht im Traum durch den Nationalpark. Begleitet von Geistern, formlosen Wesen und Dämonen ist sie auf der Flucht, auf der Suche – was genau geschieht, kann ich nicht sagen, dafür sind die intensiven Traumbilder zu wirr und zu kryptisch.
Es ist, als ob ich „an der Grenze“ festhängen würde. Ein unangenehmes Gefühl: ich will schließlich „Da“ sein! Dafür meditiere ich seit Jahren – und das normalerweise durchaus erfolgreich. Und auf einmal fühle ich mich, als wäre ich zweigeteilt.
Ich versuche, diese Grenzerfahrungen, die mich immer noch gefangen halten, zu strukturieren:
Am einfachsten zu fassen ist die pyhsische Grenze: ein fünf Meter hoher Zaun zwischen Polen und Belarus, gekrönt mit Stacheldraht, bewacht von schwer bewaffnetem Militär. Das Grenzregime dient der Abwehr von Flüchtlingen.
Womit ich bei der nächsten Grenze angekommen bin: der zwischen Zivilisation und Barbarei. An der Grenze, die quer durch den Nationalpark von Bialowieza führt, enden EU und NATO. Hier bin ich dem „Schatten“ von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit begegnet: der eigenen Bevölkerung gegenüber zivil, Fremden gegenüber brutal. Der Tod von Flüchtlingen auf der anderen Seite des Zaunes und im Sumpfland des Nationalparks wird billigend in Kauf genommen.
Dazu kommen all die schrecklichen Grausamkeiten, die hier in der Vergangenheit geschehen sind: ich wanderte, inmitten phantastischer Natur, von einem Mahnmal zum nächsten: hier wurden 222 Dorfbewohner erschossen, da 900 jüdische Männer, in der Sperrzone eine unbekannte Zahl Partisanen, die Ränder der Wege werden nicht – wie in Deutschland – von Kreuzen für Verkehrsopfer, sondern für von Scharfschützen niedergemähte sowjetische Soldaten geziert. Dazu die Überreste niedergebrannter Dörfer in Wäldern und Heiden.
„Hitlerowoow“ – wie die deutsche Besatzung hier umschrieben wird – hat tiefe Spuren hinterlassen. Und das, was ich sah, war nur die Oberfläche, markiert durch eine institutionalisierte Erinnerungskultur.
In der Tiefe – glaubte ich zu spüren und zu „sehen“ – ist der Schmerz so vielschichtig, differenziert und dicht wie die unendlich vielen Geruchsmoleküle, die der uralte Wald verbreitet.
Dieser Schmerz befindet sich auf der anderen Seite einer unsichtbaren Grenze. Abgetrennt nicht durch eine physische Barriere, sondern durch eine energetische. Und hinter diesem seltsamen Grenzregime scheint meine Seele festzuhängen.
Irgendwie – so kommt es mir zumindest vor – haben im Urwald von Bialowieza die Gesetze von Zeit und Raum ihre Bedeutung verloren. Es gibt dort kein „Gestern“ und „Heute“. Es gibt nur ein einziges großes „Jetzt“, in dem alles, was jemals in diesem Wald geschehen ist, aufzugehen scheint.
„…und so gibt es weder Alter noch Tod, noch ein Ende von Alter und Tod…“ heißt es im Herz-Sutra.
Genauso ist es dort: einerseits ist im Urwald „Tod“ bedeutungslos. Nichts dort stirbt wirklich, alles ist einfach nur beständiger Wandel: jede Pflanze, jeder Organismus, jedes Tier, jeder Mensch ist einfach nur Energie. „Tod“ ist lediglich ein Wechsel der Energie-Frequenz.
Nie zuvor bin ich an einem Ort gewesen, der eine solche Vitalität verströmt. Alles im Urwald von Bialowieza ist Leben.
Und gleichzeitig bin ich noch nie zuvor an einem Ort gewesen, an dem es so viel „Tod“ gibt: der Urwald ist ein einziges Schlachtfeld! Baumriesen werden von Pilzen gefällt, Wisentkinder von Wölfen gerissen. Jedes Jungtier, das im Wald geboren wird – von der winzigsten Insektenlarve bis zum Elchkalb – muss einem ganzen Heer von Feinden standhalten, wenn es überleben will.
Dass ist die Quintessenz meiner Erfahrung: es gibt keinen Tod – und gleichzeitig ist er überall.
Im Grunde, sinniere ich weiter, ist „Tod“ dort greifbar, wo er mit Schmerz und Leid verbunden ist. Auf der energetischen Ebene handelt es sich um eine Art „Blockade“, der natürliche Fluß der Transformation scheint gestört zu sein.
All diese Symbole für Leid und Tod, mit denen ich im Nationalpark konfrontiert wurde – der Grenzzaun, der Schädel des Wisentkindes, all die Mahnmale und Gedenktafeln für die Opfer von Kriegsverbrechen – markieren Orte und Geschehen, an denen Lebensenergie aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Fazit: Ich wurde an einen Ort urwüchsiger Vitalität geschickt, der mit Symbolen energetischer Blockaden gespickt ist.
Ich bin mir bewusst, dass das so esoterisch wie weltfremd klingt. Aber leider bin ich so gestrickt. Ich funktioniere komplett intuitiv. Mir ist weder politische Durchschlagkraft noch zivilgesellschaftlicher Aktionismus gegeben – so sehr ich das auch bedauere.
Trotzdem bin ich aufgefordert, etwas zu unternehmen. Im Rahmen dessen, was mir möglich ist.
Ich denke an das Versprechen, dass ich den formlosen Wesen an der Gedenkstätte für die Opfer des Massenmordes im Wald von Bialowieza gab: dass ich wiederkommen und Riwo Sangchö für sie praktizieren würde.
Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, schreibe ich am nächsten Morgen eine Textnachricht an Suriyel: Wann er denn in seinem Buddhistischen Zentrum die nächste Grüne-Tara-Praxis und Riwo Sangchö anbieten würde? Und ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich dazu käme?
„Nächsten Sonntag“, kommt es zurück. Und wenn es mir nicht zu mühsam wäre, so weit zu fahren für ein bisschen Praxis, wäre ich willkommen…